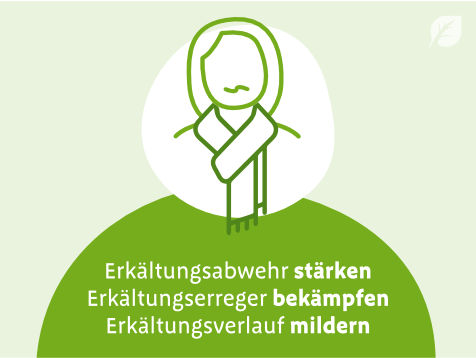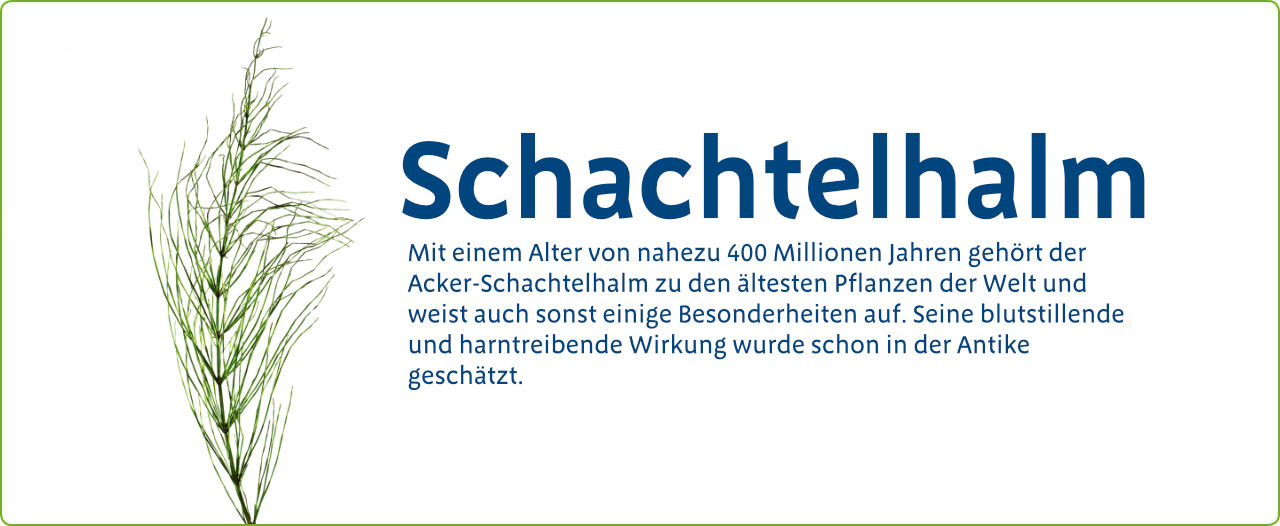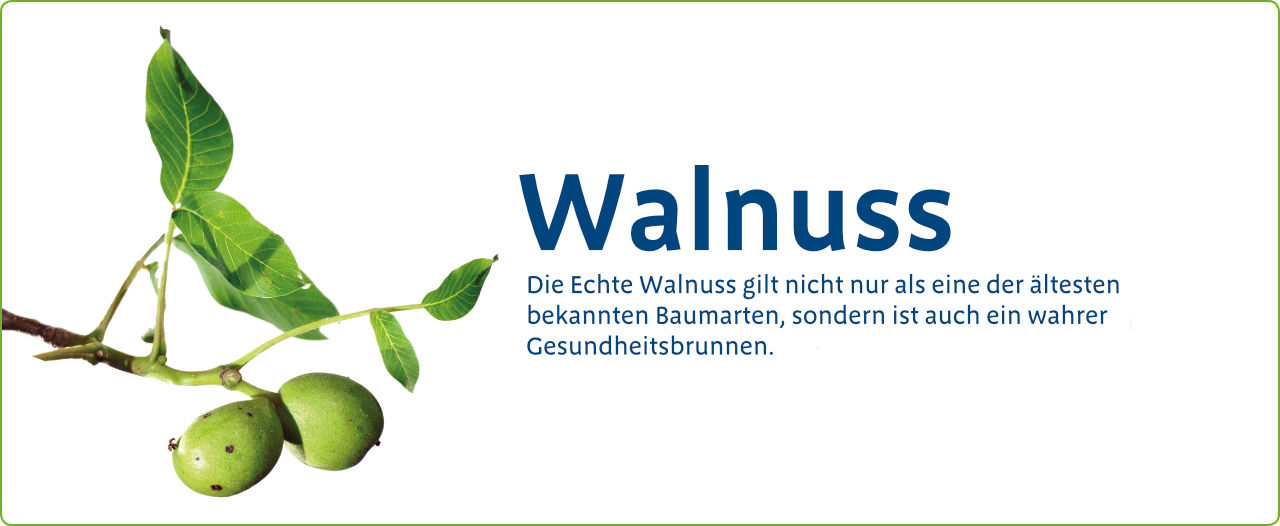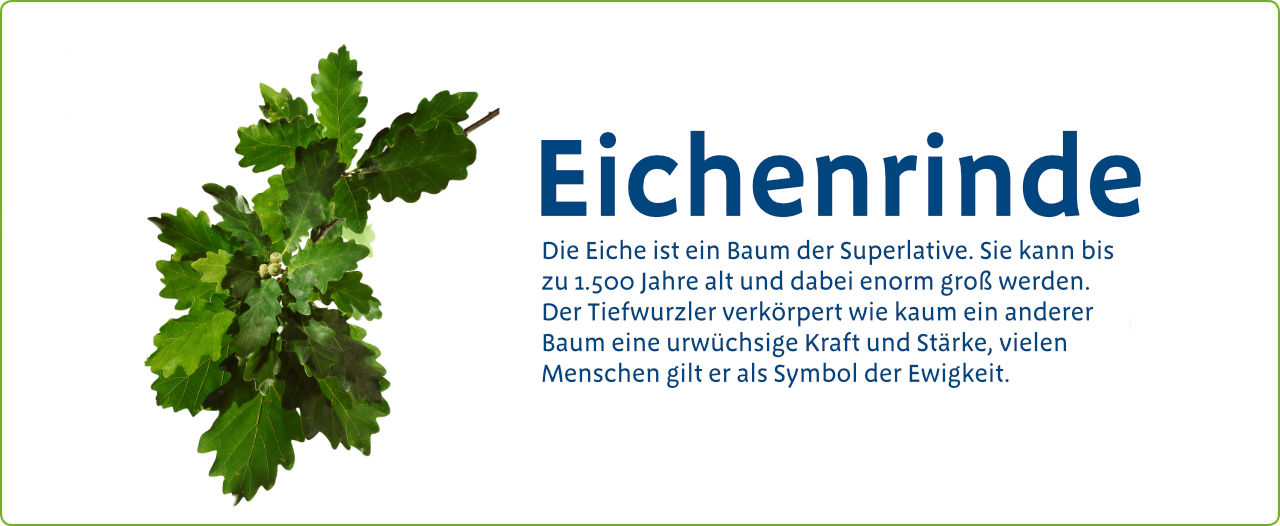Löwenzahn (Taraxacum officinale)
Die natürliche Heilkraft des Löwenzahns
Während Kinder den Gewöhnlichen Löwenzahn als Pusteblume lieben, schmähen ihn viele Erwachsene als Unkraut im Garten. Die unverwüstliche und anpassungsfähige Pflanze trotzt der Sommerhitze und wächst auch noch aus der kleinsten Asphaltritze. Ihre Unempfindlichkeit, Zähigkeit und Lebenskraft kann man als gutes Omen für die menschliche Verwendung als Heilpflanze und in der Küche interpretieren: Der Löwenzahn ist ein besonderes Kraut, das es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Schon im Altertum wussten die Heilkundigen das zu schätzen.
Erfahren Sie auf dieser Seite mehr zu folgenden Themen:
► Allgemeines zum Löwenzahn
Allgemeines zum Löwenzahn:
Steckbrief Löwenzahn (Taraxacum officinale)
- Beschreibung: krautige Pflanze aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae), die in allen Pflanzenteilen einen charakteristischen weißen Milchsaft enthält
- Synonyme: Pusteblume, Kettenblume, Milchstöck, Bettnässer, Hundeblume, Kuhblume, Mühlenbuschen, Rahmstock, Ringelstock
- Vorkommen: vor allem auf der Nordhalbkugel in Europa und Asien auf Wiesen und im Garten (als „Unkraut“)
- wichtige Inhaltsstoffe: Polyphenolsäurederivate (Taraxosid), Terpene, Polysaccharide (Inulin, Schleimstoffe), Bitterstoffe, Mineralien, Spurenelemente und Vitamine
- Anwendungsgebiete: Erkältungen, Appetitlosigkeit, Störung des Gallenflusses, Wiederherstellung der Leber- und Gallenfunktion, Verdauungsstörung, Völlegefühl und Blähungen, zur Anregung der Harnausscheidung und Durchspülung der Harnwege, z. B. bei Harnwegserkrankungen, Rheuma und zur Vorbeugung von Nierensteinen
- Mögliche Anwendungen: Tee, Tinktur, pflanzliche Arzneimittel, Kaltwasserauszug, Frischpflanzenpresssaft, Pflanzensaft, äußerliche Anwendung auf der Haut
Woher kommt der Löwenzahn?
Der Gewöhnliche Löwenzahn ist auf der nördlichen Halbkugel weit verbreitet und im westlichen Asien und Europa heimisch, wobei er ursprünglich möglicherweise aus Zentralasien stammt. Als robustes und verschlepptes „Unkraut“ ist die bekannte Pflanze mittlerweile weltweit anzutreffen. Das gilt selbst für Höhenlagen von bis zu 2.800 Metern, allerdings bei deutlich niedrigerem Wuchs als im Flachland. Dort gedeiht die Pusteblume auch an unwirtlichen Standorten wie etwa Brachflächen, Schutthalden oder Rissen und Ritzen von Gemäuern oder Straßenbelägen.
Wie erkennt man die Pflanze?
Auch Pflanzenunkundige wissen in aller Regel, wie der Löwenzahn aussieht: leuchtend gelbe Blüten, die von März bis Mai/ Juli und nicht selten nochmal im Herbst blühen; charakteristische Früchte, die wie kleine Fallschirme aussehen und die Pflanze für Kinder und manch Erwachsenen zur „Pusteblume“ machen; und ein grüner Stängel mit löwenzahnartig gezackten Blättern außen und einer milchig weißen Flüssigkeit innen.
Es besteht übrigens die Gefahr, den Gewöhnlichen Löwenzahn mit einer anderen Gattung Löwenzahn (Leontodon) zu verwechseln, die nicht als Heilpflanze gilt. Zur Unterscheidung eignen sich die grünen Hüllblätter, die den Blütenstand umgeben. Diese sind beim Gewöhnlichen Löwenzahn nach unten gebogen, beim Leontodon stehen sie in zwei Reihen und sind manchmal behaart. Wem die Sammel-Erfahrung fehlt, sollte die Pflanzendroge am besten in der Apotheke besorgen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Woher kommt der Name?
Woher der Löwenzahn (Taraxacum officinale) seinen deutschen Namen hat, ist klar: Die unregelmäßig gelappten und tief eingeschnittenen Blätter erinnern an die Zähne eines Löwens. Der Zweitname „Pusteblume“ beschreibt anschaulich die Eigenart der Samen, sich nach der Blüte wie kleine Fallschirmchen in die Luft pusten zu lassen.
Bei der botanischen Namensgebung geht es um die Bedeutung als Heilpflanze: Der Gattungsname lässt sich aus den altgriechischen Begriffen „taraxo“ (Störung), „akos“ (Heilmittel) und „taraxacis“ (Entzündung) ableiten. Die Zusatzbezeichnung „officinale“ geht auf das lateinische Wort „officina“ zurück und lässt auf die Verwendung als Arzneimittel schließen. Seit dem Spätmittelalter ist von der „Offizin“ die Rede – womit heute noch der Verkaufsraum einer öffentlichen Apotheke bezeichnet wird.
Löwenzahn als Heilpflanze:
Worauf beruht die medizinische Wirksamkeit des Löwenzahns?
Warum der Löwenzahn manchmal auch als „Wunderkraut“ bezeichnet wird, zeigt die Zusammenstellung seines Wirkprofils:
- antiviral
- antibakteriell
- entzündungshemmend
- schmerzlindernd
- verdauungsfördernd, appetitanregend und gallebildend
- anregend auf die Leber
- harnfördernd
- durchblutungsfördernd
- beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt
- krampflösend
Medizinisch bedeutsam ist vor allem der Reichtum des Löwenzahns an Bitterstoffen. Im menschlichen Körper fördern sie die Produktion von Speichel und Magensäure sowie von Verdauungshormonen bzw. -enzymen. Das regt den Appetit und die Leber an, bringt den Stoffwechsel in Schwung und steigert die Produktion sowie den Abfluss der Galle. Die verbesserte Aufnahme von Nährstoffen wie Vitamin B12 und Eisen hilft gegen Müdigkeit und Antriebslosigkeit.
Beginnende Erkältung?
Imupret® N
Die einzigartige 7-Pflanzenkombination kann:
- Erkältungsabwehr stärken
- Erkältungserreger bekämpfen
- Erkältungsverlauf mildern
Wenn Erkältung entsteht: Imupret!
Löwenzahn Wirkung - schonend, aber effektiv
Ein besonders schönes Beispiel für die sanfte Heilkraft der Natur im Unterschied zu synthetischen Medikamenten ist die harntreibende Wirkung der Arzneipflanze, die nach wissenschaftlicher Auffassung auf ihrem hohen Kaliumgehalt beruht: Während einerseits der Harnfluss zunimmt, werden dem Organismus gleichzeitig wichtige Mineralstoffe zugeführt. Im Gegensatz zu chemisch-synthetischen Entwässerungstabletten (Diuretika) ist deshalb ein Mineralstoffmangel als Nebenwirkung nicht zu befürchten.
Welche Inhaltsstoffe finden sich im Löwenzahn?
Der Löwenzahn besitzt ein reichhaltiges Spektrum an Inhaltsstoffen, die nicht nur heilsam wirken können, sondern auch mit Blick auf eine gesunde Ernährung sehr interessant sind:
Polyphenolsäurederivate (Taraxosid): entzündungshemmende, antivirale bzw. antimikrobielle Wirkung
Terpene: leberschützend
Polysaccharide (Inulin, Schleimstoffe): Immunstärkung
Bitterstoffe: Anregung von Gallentätigkeit und Verdauung
Mineralien (Kalium, Calcium, Natrium, Schwefel)
Spurenelemente (Eisen, Mangan, Zink)
Vitamine (A, C, E): Immunstärkung
Bei welchen Leiden und Krankheiten kommt Löwenzahn zur Anwendung?
Eines der vielen Anwendungsgebiete der Heilpflanze Löwenzahns ist die klassische Erkältung. Hier hilft die Pflanze bei der Bekämpfung der Erreger und unterstützt den Körper gleichzeitig beim Heilungsverlauf.
Weitere Anwendungsgebiete des Löwenzahns sind:
- Appetitlosigkeit
- Störung des Gallenflusses
- Verdauungsstörung
- dyspeptische Beschwerden wie Völlegefühl und Blähungen
- zur Anregung der Harnausscheidung (Diurese) und Durchspülung der Harnwege, z. B. bei Harnwegserkrankungen, Rheuma und zur Verhütung von Nierensteinen.
Außerdem wird der Löwenzahn in der Volksheilkunde bei Durchblutungsstörungen, als leichtes Abführmittel, bei trockener Haut, bei Warzen, bei Schwächezuständen und zur Förderung Leistungsfähigkeit empfohlen. Ähnlich wie der Ginseng wird auch der Löwenzahn als allgemeines Stärkungsmittel (Tonikum) geschätzt.
Was ist bei der Anwendung zu beachten?
Relevante Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sind beim Löwenzahn nicht bekannt. Eventuell kann es zu Magenbeschwerden aufgrund einer Übersäuerung durch die Bitterstoffe kommen. Bei Personen mit empfindlicher Haut ist bei häufigem Kontakt mit dem Milchsaft unter Umständen eine Kontaktdermatitis möglich. Auch bei einer bekannten Allergie sollte Löwenzahn nicht angewendet werden, ebenso nicht auf gesunder Haut.
Weil die in Löwenzahn in hohen Dosen harntreibend wirkt, sollten Sie ihn außerdem lieber nicht abends einnehmen.
Anwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten
Welche Pflanzenteile werden verwendet?
Beim Löwenzahn lassen sich alle Pflanzenteile naturheilkundlich nutzen: Die Wurzel ebenso wie das frische Kraut. Beim Gehalt an Wirkstoffen gibt es jedoch Unterschiede, wobei auch die Jahreszeit eine Rolle spielt.
Während man die frischen Löwenzahnblätter vor der Blüte erntet und trocknet, werden die Wurzeln üblicherweise im Herbst gesammelt, da sie dann weniger Bitterstoffe als im Frühjahr enthalten und dafür reichlich Inulin. Im Herbst entfallen bis zu 40 % des Kohlenhydrat-Gehalts auf Inulin, während im Frühjahr die Fructose mit bis zu 18 % stark vertreten ist. Besonders für Menschen mit Diabetes, denen Inulin als blutzuckerneutraler Stärkeersatz im Löwenzahn-Gemüse dienen kann, ist das relevant.
Welche Zubereitungsformen gibt es?
Die positiven Wirkungen des Löwenzahns lassen sich in verschiedensten Zubereitungsformen nutzen, etwa als Flüssig- oder Trockenextrakt, Tinktur, Kaltwasserauszug, Frischpflanzenpresssaft, Pflanzensaft oder Tee. Die Produktpalette ist vielfältig, auch Löwenzahnkaffee und Löwenzahnwein sind im Angebot. Allgemein wird eine regelmäßige Anwendung über 4–6 Wochen empfohlen.
Sie können viele Zubereitungen auch selbst herstellen. Das Pflanzenmaterial sollten Sie dann frisch über den Handel in Bio-Qualität oder als Droge in der Apotheke beziehen. Die Ernte im eigenen Garten ist natürlich auch möglich. Vom Pflücken auf Wiesen wird dagegen abgeraten, da starker Löwenzahn-Bewuchs als ein Indikator für Überdüngung gilt und die inhaltliche Qualität möglicherweise beeinträchtigt sein könnte.
Bei der Selbstherstellung von hochwertigen Löwenzahnzubereitungen tut man sich allerdings mit der schonenden Verarbeitung des Materials schwer, die erforderlich ist, um die wertvollen Inhaltsstoffe möglichst weitgehend zu erhalten. Hier bieten sich die Produkte aus dem Handel als bessere Option an, wobei es löwenzahnhaltige Produkte nicht nur in flüssiger Form, sondern auch als Paste oder Pulver gibt.

Wie wird Löwenzahn Tee zubereitet?
Für die Zubereitung von Löwenzahn Tee können sowohl die getrockneten oder frischen Blätter als auch die Wurzeln der Pflanze verwendet werden.
Löwenzahnblatt-Tee: einen gehäuften Teelöffel der zerkleinerten Blätter (frische oder getrocknete Blätter) in einem Teefilterbeutel mit 200 bis 250 ml kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen; anschließend den Beutel herausnehmen und den Tee in kleinen Schlucken trinken.
Löwenzahnwurzel-Tee: verwendet werden im Frühjahr vor der Blüte gesammelte Wurzeln; diese trocken säubern (nicht waschen), längs in Streifen schneiden und an einem luftig-warmen Ort über wenige Tage trocknen; dann etwa 2 Teelöffel davon über Nacht in kaltem Wasser ansetzen und am nächsten Tag kurz aufkochen, abgießen und täglich mindestens drei Tassen des Tees trinken.
Wofür wird Löwenzahn äußerlich angewendet?
In der Volksheilkunde kommt der Löwenzahn nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich zum Einsatz, etwa bei Hautproblemen, schlecht heilenden Wunden, Hühneraugen, Hornhaut und Warzen. Hier stehen die entzündungshemmenden, antibakteriellen und antiviralen Wirkungen der Heilpflanze im Vordergrund. Bei Insektenstichen oder -bissen sind vor allem ihre schmerz- und/oder juckreizlindernden Eigenschaften relevant.
Für die Behandlung wird der milchige Pflanzensaft aus den Stängeln zwei- bis mehrmals täglich über mehrere Wochen auf die betreffenden Stellen aufgetragen. Erscheint das Benetzen mit dem Stängelsaft nicht als ausreichend, kann man im Mixer mit etwas Wasser auch einen Brei aus der ganzen Pflanze herstellen und z. B. für einen Umschlag verwenden.
Löwenzahn (Taraxacum officinale) – wichtige Fragen und Antworten auf einen Blick
Ist der Löwenzahn giftig?
Nein, Löwenzahn ist nicht giftig. Gegen Löwenzahn auf der Speisekarte spricht nichts – im Gegenteil! Mit seinem reichen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen ist er gut für die Gesundheit und zudem ein leicht zugängliches Lebensmittel.
Es kommt nur darauf an, was man isst: Die Löwenzahnblüten sind gut genießbar, sie enthalten keinerlei Giftstoffe. Beim Milchsaft in den Stängeln sieht das etwas anders aus. Dieser kann leichte Vergiftungserscheinungen hervorrufen – allerdings nur beim Verzehr großer Mengen. Damit tut der Milchsaft nur seine Pflicht, denn er soll die Pflanze vor Wildfraß und Infektionen schützen.
Ist Löwenzahn gesund?
Absolut, die Pflanze hat viele wertvolle Eigenschaften für die Gesundheit. Sie eignet sich hervorragend als Tee oder Ergänzung in der Küche. Verwenden Sie frisch am besten die Blüten und Blätter, diese enthalten weniger unbekömmliche Stoffe als die milchhaltigen Stängel und sind besser verträglich.
Damit lässt sich beispielsweise ein Salat zubereiten. Auch Rezepte für Löwenzahn-Pesto oder Löwenzahn-Honig sind besonders im Frühling zur Erntezeit beliebt. Für Tees werden vor allem getrocknetes Kraut oder die Wurzeln verwendet.
Wie viel Löwenzahn darf man essen?
Der Verzehr ist sowohl im frischen als auch im getrockneten Zustand unbedenklich. Erst bei dem Verzehr großer Mengen kann Löwenzahn zu Übelkeit und Magen-Darm-Problemen führen. Grund dafür sind die enthaltenen Bitterstoffe – in geringen Mengen sind diese aber sehr wertvoll. Außerdem wirkt Löwenzahn harntreibend, daher sollte das Kraut nicht abends eingenommen werden.
Zusammen mit diesen Heilpflanzen trägt der Löwenzahn zur Wirkung des Phytotherapeutikums in Imupret® N bei Erkältungen bei:
Bildnachweise
Adobe Stock: Andreas | Adobe Stock: vvvita | Adobe Stock: chekman