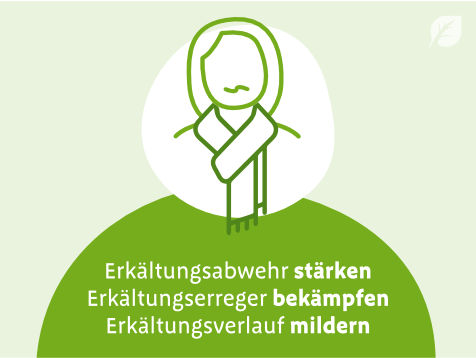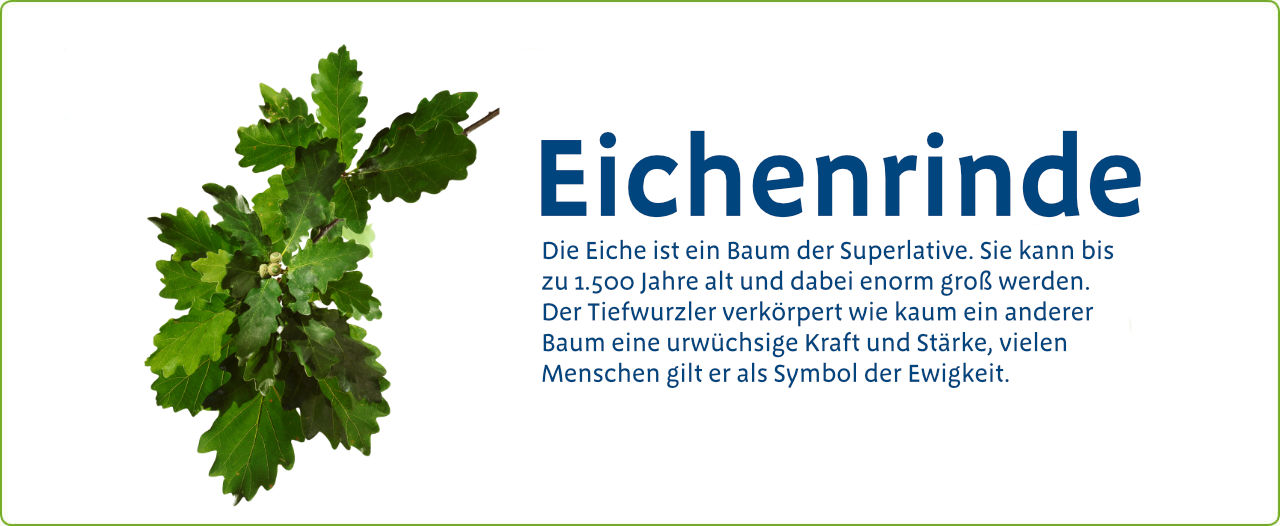Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense)
Die natürliche Heilkraft des Acker-Schachtelhalms
Der Ackerschachtelhalm, auch Schachtelhalm oder Zinnkraut genannt, ist eine schon seit der Antike bekannte Heilpflanze mit vielfältigen Wirkungen. Vor allem die darin enthaltene Kieselsäure und ihre Salze sowie weitere Mineralstoffe und Spurenelemente haben positive Effekte auf Haut und Schleimhäute und wirken fördernd auf das Immunsystem – das macht man sich beispielsweise bei der Behandlung von Erkältungen zunutze. Mehr dazu lesen Sie im folgenden Beitrag.
Erfahren Sie auf dieser Seite mehr zu folgenden Themen:
► Allgemeines zum Ackerschachtelhalm
► Ackerschachtelhalm als Heilpflanze
Allgemeines zum Ackerschachtelhalm:
Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense)
Steckbrief Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense)
- Beschreibung: krautige Pflanze aus der Gattung der Schachtelhalme (Equisetum) innerhalb Familie der Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae)
- Synonyme: Schachtelhalm, Zinnkraut, Acker-Schachtelhalm, Scheuerkraut, Acker-Zinnkraut, Katzenwedel, Pfannenputzer, Schaftheu
- Vorkommen: vor allem auf der Nordhalbkugel auf Äckern, feuchten Böden an Wiesenrändern und Böschungen
- wichtige Inhaltsstoffe: Kieselsäure, Silizium, Falvonoide, Polysaccharide, Kalium, Calcium und Magnesium
- Anwendungsgebiete: Erkältungen, Entzündungen der Harnwege und Blase, Wassereinlagerungen, Wundheilung
- Mögliche Anwendungen: Tee, Tinktur, pflanzliche Arzneimittel, äußerliche Anwendung als Badezusatz
Wie sieht Ackerschachtelhalm aus?
Der Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense) ist ein grünes Kraut aus der Gattung Equisetum, das zu einem großen Teil auch unterirdisch wächst. Im Frühjahr bilden sich blassgelbliche Stängel mit einer Sporenähre an der Spitze. Später wachsen dann grüne Triebe, die bis zu 50 cm hoch werden.
Die Wuchsform des Ackerschachtelhalms ist sehr charakteristisch: Der Stängel erscheint im Querschnitt hohl und gerippt, die Seitentriebe sternförmig. Die Äste sind in Quirlen angeordnet, an den Blattscheiden finden sich kleine Zähne, von denen es so viele wie Rippen (6–20) gibt. Die Sprossen sind astlos, bräunlich gefärbt und tragen Ähren. Die Sporenreife dauert von März bis April.
Woher kommt die Pflanze und wo wächst sie heute?
Die Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae) können mit einem Alter von fast 400 Millionen Jahren als lebende Fossilien bezeichnet werden. Sie sind die letzten Nachfahren einer ehemals artenreichen Gruppe innerhalb der Gefäßsporenpflanzen (Pteridophyta). In frühester Zeit wuchsen sie baumhoch und bildeten zusammen mit Riesenfarnen die ersten Wälder auf der nördlichen Halbkugel. Die Überreste dieser Wälder lagern immer noch als Steinkohle tief in der Erde, etwa im Ruhrgebiet. Heute gibt es nur noch etwa 30 Schachtelhalm-Arten, die in der Regel Wuchshöhen von 2 Metern selten überschreiten.
Die Pflanze wird auch als Ackerunkraut bezeichnet und wächst auf Feldern, an lehmigen, feuchten Wiesenrändern, in Gräben und auf Böschungen. Wie Moose und Farne vermehrt sich der Schachtelhalm nicht über Blüten und Früchte, sondern über Sporen, die durch den Wind verbreitet werden. Diese ungeschlechtliche Art der Vermehrung half den Schachtelhalmen, der Ausrottung zu entgehen.
Warum wird die Pflanze auch Zinnkraut genannt?
Eine Besonderheit der Schachtelhalme ist die Einlagerung von Kieselsäure in die Zellwand. Diese Eigenschaft brachte der Pflanze den volkstümlichen Namen Zinnkraut ein. Denn aufgrund der Kieselkristalle, die als natürliches Putzmittel fungierten, wurde der Schachtelhalm früher zur Reinigung von Zinngeschirr verwendet.
Woher kommt der Name?
Im deutschen Namen kommt der biologische Aufbau des Stängels zum Ausdruck, der sich aus mehreren, ineinander verschachtelten Abschnitten zusammensetzt.
Die volkstümliche Bezeichnung „Zinnkraut“ ist dem hohen Gehalt an Kieselsäure und der resultierenden Eigenschaft als „pflanzliches Schmirgelpapier“ geschuldet.
Der Name Equisetum bedeutet Pferdeschweif
Der botanische Gattungsname Equisetum arvense leitet sich aus der Assoziation der hellbraunen bis rötlichen Sporentriebe mit einem Pferdeschweif (equistum) ab. Der begleitende Artname verweist auf den Acker (arvum) als beliebtem Gewächs-Standort.
Der kreative Volksmund hat für den Schachtelhalm neben seinem wissenschaftlichen Namen natürlich noch viele weitere Bezeichnungen parat, die zumeist etwas mit seiner früheren Verwendung im Haushalt zu tun haben, z. B.: Kannen-, Löffel- oder Scheuerkraut, aber auch Hakenschwanz oder Reibwisch.
Geschichte des Ackerschachtelhalms
Mit einem Alter von nahezu 400 Millionen Jahren gehört der Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense) zu den ältesten Pflanzen der Welt und weist auch sonst einige Besonderheiten auf.
Seine blutstillende und harntreibende Wirkung wurde schon in der Antike geschätzt. Danach geriet das Kraut allerdings längere Zeit in Vergessenheit, bis es von Sebastian Kneipp wiederentdeckt wurde. Der heilkundige Pfarrer und Namensgeber der Kneipp-Medizin setzte es u. a. gegen Rheuma und Gicht ein. Heute stehen neben der Anwendungsmöglichkeit als Tee auch moderne Fertigarzneimittel für den einfachen Gebrauch des Ackerschachtelhalms zur Verfügung.
Ackerschachtelhalm als Heilpflanze:
Welche Inhaltsstoffe sind für die medizinische Wirkung relevant?
Dem Reichtum an Silizium und anderen Spurenelementen sowie an Mineralstoffen wie Kalium, Calcium und Magnesium verdankt der Ackerschachtelhalm seine positive Wirkung auf Haut und Schleimhaut und sein vielseitiges Anwendungsspektrum.
Dem in der Kieselsäure enthaltenen Silizium wird eine immunfördernde Wirkung zugesprochen, indem es an der Bildung von Fresszellen, den Phagozyten, beteiligt ist. Weitere positive Effekte betreffen den Aufbau und die Stabilität von Bindegewebe, Sehnen, Bändern, Haut, Haaren und Knochen sowie Zähnen und Nägeln. Der hohe Kaliumgehalt des Schachtelhalms regt bei innerer Anwendung zudem die Nierentätigkeit an.
Im Hinblick auf die medizinische Anwendung sind außerdem Saponine und Flavonoide therapeutisch wichtige Inhaltsstoffe. Sie haben immunstärkende, antientzündliche und antimikrobielle Effekte.
Für welche Anwendungsgebiete wird das Heilkraut empfohlen?
Wegen seiner positiven Wirkungen auf die körpereigene Abwehr bei Erkältungen und seinen entzündungshemmenden Eigenschaften wird die Heilpflanze gegen Erkältungskrankheiten eingesetzt.
Bereits im Altertum wurde der Ackerschachtelhalm zudem aufgrund seiner harntreibenden Wirkung häufig zur Behandlung von Erkrankungen der Nieren und Harnwege verwendet. Geschätzt wurde er u. a. auch als Heilmittel zur Blutstillung und zur Entwässerung des Gewebes bei Ödemen. Die Möglichkeiten seiner gesundheitsfördernden und therapeutischen Anwendung als Schachtelhalmtee oder Fertigpräparat sind breit gefächert.
Auch heute noch gelten folgende Anwendungsempfehlungen:
- innerlich:
- bei Wassereinlagerungen (Ödemen) nach langem Stehen oder aufgrund zerstörter Lymphgefäße und
- zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß
- äußerlich:
- zur unterstützenden Behandlung von schlecht heilenden Wunden
Neben der durch wissenschaftliche Studien belegten Wirkung gibt es in der Volksheilkunde noch weitere Krankheiten, bei denen das Zinnkraut zur Anwendung kommt:
- Mandelentzündung
- Husten, Bronchitis, Halsschmerzen, Nebenhöhlenentzündung
- Blasenschwäche, häufiger Harndrang, Blasenkrämpfe und Inkontinenz
- entzündliche Hauterkrankungen, Stauungsekzem
- Zahnfleischentzündung, Zahnfleischschwund (Parodontose)
- rheumatische Beschwerden und Gicht
- Schleimbeutel- und Knochenhautentzündung
- Stärkung von Sehnen und Bändern
- Gefäßschutz gegen Fettablagerungen in den Arterien
Das Schachtelhalmkraut ist auch ein häufiger Bestandteil von Blasen- und Nierentees, beispielsweise in Kombination mit Birkenblättern und Goldrute.
Wie hilft der Ackerschachtelhalm gegen Erkältung?
Zu den phytotherapeutisch relevanten Inhaltsstoffen des Heilkrauts zählen Kieselsäure und ihre Salze (Silikate), Saponine und Flavonoide. Sie unterstützen die Erkältungsabwehr, wirken entzündungshemmend und antimikrobiell, sprich sie reduzieren die krankheitserregenden Bakterien. Diese Eigenschaften sind bei Erkältungen gefragt und machen den Schachtelhalm beispielsweise zu einer wertvollen Komponente in Imupret® N.
Beginnende Erkältung?
Imupret® N
Die einzigartige 7-Pflanzenkombination kann:
- Erkältungsabwehr stärken
- Erkältungserreger bekämpfen
- Erkältungsverlauf mildern
Wenn Erkältung entsteht: Imupret!
Was ist bei der Anwendung zu beachten? Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Für Ackerschachtelhalm sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt und als Nebenwirkung lediglich leichte Magenbeschwerden in seltenen Fällen.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Der Ackerschachtelhalm kann leicht mit dem giftigen Sumpfschachtelhalm verwechselt werden, deshalb: nicht selbst sammeln!
Anwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten
Welche Pflanzenteile werden verwendet?
Für Tee und Fertigarzneimittel werden nur die oberirdischen Pflanzenteile des Zinnkrauts genutzt. Die unfruchtbaren grünen Sommertriebe enthalten etwa 10 % mineralische Bestandteile (Kieselsäure und wasserlösliche Silikate) sowie ca. 1 % Flavonoide (v. a. Kämpferol und Quercetin).
Schachtelhalm Extrakt – Wirkungen
Die verwendeten Pflanzenteile stehen geschnitten, beispielsweise für die Zubereitung eines Schachtelhalm-Tees, zur Verfügung. Des Weiteren gibt es Schachtelhalmkraut als pulverisierte Droge in Tabletten, als Trockenextrakt in Dragees und Schachtelhalmkapseln, als alkoholischer Auszug in Tropfen und Saft sowie öliger Auszug bzw. Glycerinextrakt in Einreibungen.
Zur äußeren Anwendung als Unterstützung der Wundheilung können auch Zinnkraut Umschläge aus den oberirdischen Teilen der Pflanze verwendet werden.
Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense) – wichtige Fragen und Antworten auf einen Blick
Ist Schachtelhalm und Zinnkraut das gleiche?
Ja, hinter beiden Namen verbirgt sich die gleiche Pflanze. Der Name Zinnkraut ist auf seine frühere Anwendung als Scheuermittel zur Reinigung von Zinngeschirr zurückzuführen.
Der Name Schachtelhalm bzw. Ackerschachtelhalm geht auf die Struktur und den Aufbau der Pflanze zurück. Sie gehört zur Gattung der Schachtelhalme (Equiseum) innerhalb der Familie der Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae).
Für was ist Schachtelhalm gut?
Ackerschachtelhalm enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe wie Kieselsäure, Silizium und wichtige Mineralien, die ihn zu einer beliebten Heilpflanze machen. Dem Kraut werden unter anderem entzündungshemmende und immunstimulierende Eigenschaften zugeschrieben. Das macht den Schachtelhalm zu einer beliebten Heilpflanze bei Erkältungsbeschwerden. Aber auch die harntreibenden Effekte macht man sich bei Wassereinlagerungen und Nierenproblemen zunutze.
Ist Schachtelhalm eine Heilpflanze?
Der Ackerschachtelhalm war schon in der Antike eine wichtige Heilpflanze. Er gehört zu den ältesten Pflanzen der Welt. Auch Sebastian Kneipp war von den vielseitigen Wirkungen des Ackerschachtelhalms überzeugt. Heutzutage findet man das Schachtelhalmkraut auch in einigen Fertigarzneimitteln.
Wie gesund ist Schachtelhalmkraut?
Ackerschachtelhalm enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe wie Kieselsäure, Silizium, Falvonoide, Kalium, Calcium und Magnesium. Sie machen das Kraut so gesund und deshalb wird Ackerschachtelhalm auch zur Behandlung unterschiedlichster Beschwerden eingesetzt.
Zinnkraut wirkt entzündungshemmend, harntreibend und stärkend auf das Bindegewebe
Schachtelhalm hat eine stärkende Wirkung auf das Immunsystem, wirkt sich positiv auf Haut und Schleimhäute aus und fördert den Aufbau und die Stabilität von Bindegewebe, Sehnen, Bändern, Haut, Haaren, Knochen, Nägeln und Zähnen.
Zusammen mit diesen Heilpflanzen trägt der Schachtelhalm zur Wirkung des Phytotherapeutikums in Imupret® N bei Erkältungen bei:
Bildnachweise
Adobe Stock: JoannaTkaczuk | Adobe Stock: chekman