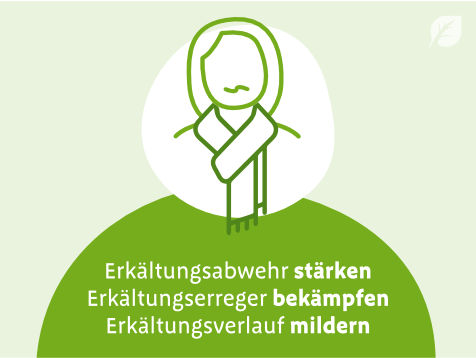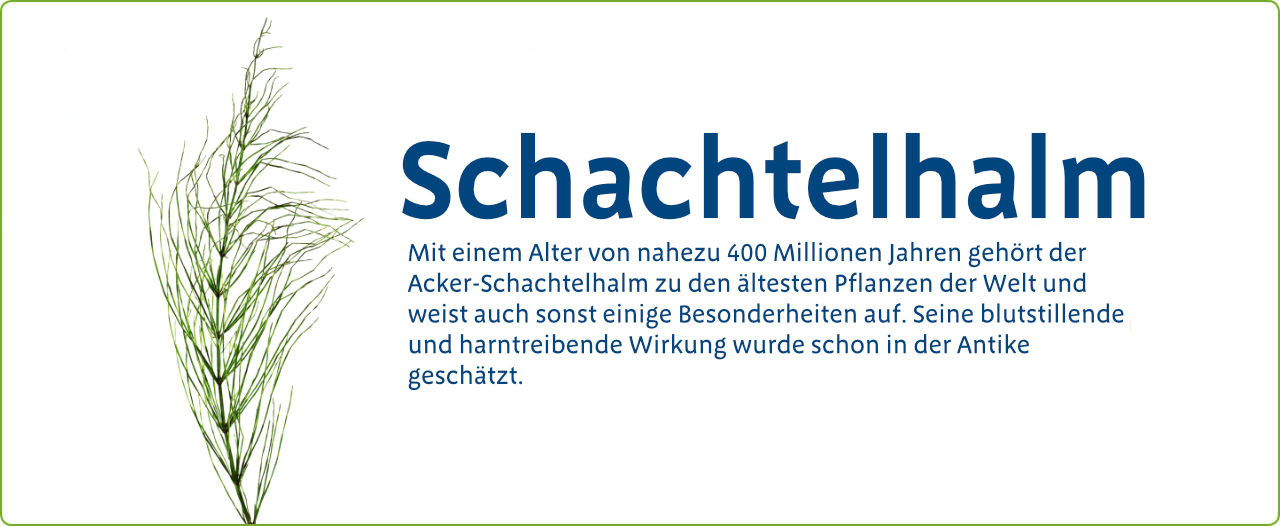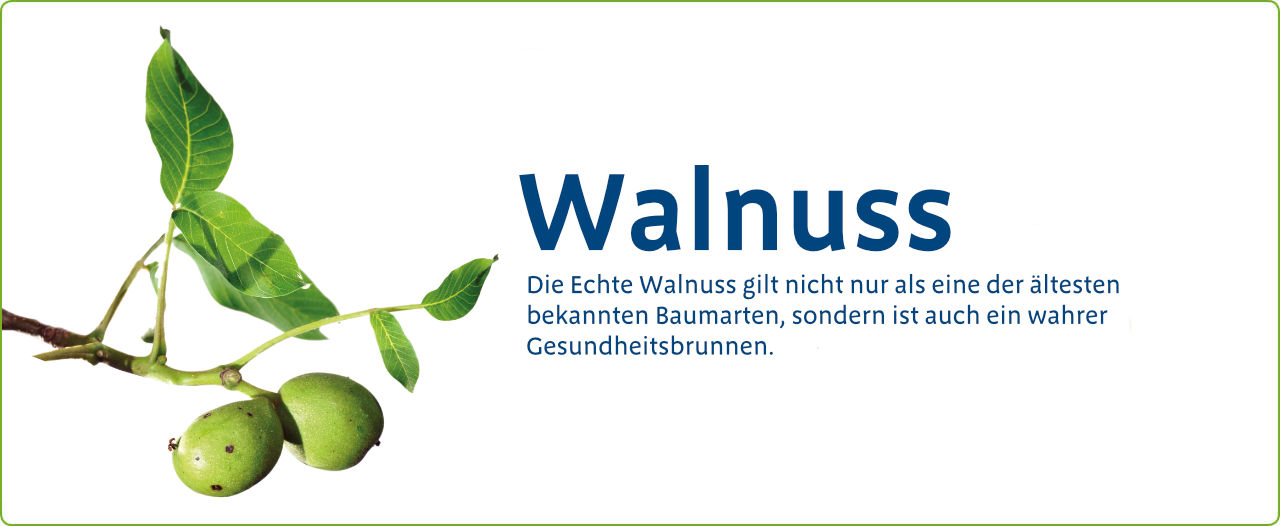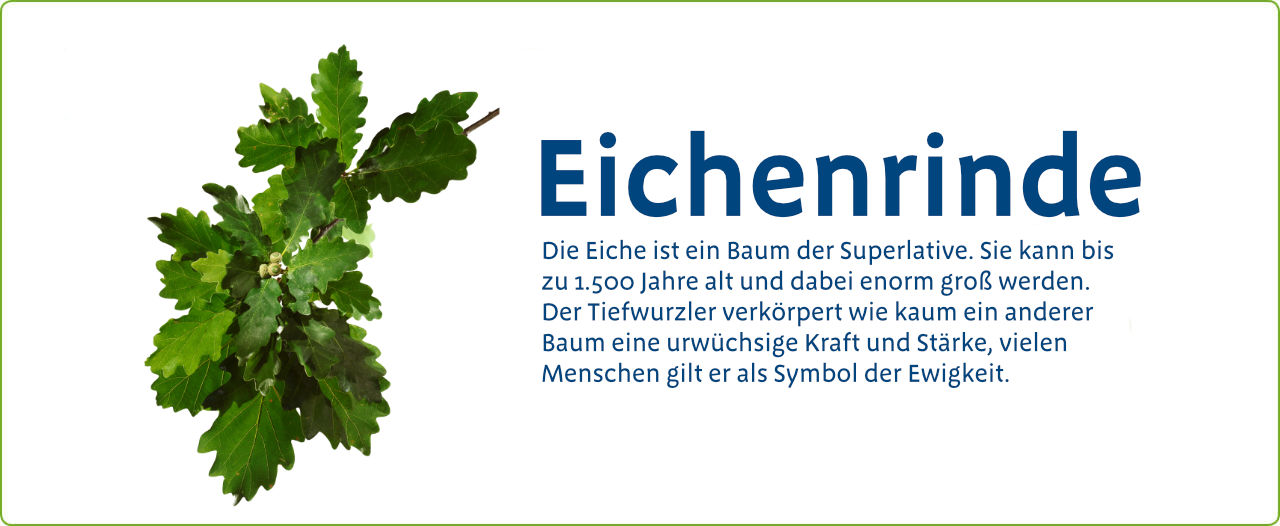Echter Eibisch (Althaea officinalis)
Die natürliche Heilkraft des Eibisch
Eibischwurzel und Eibischblätter werden besonders gerne bei akuten Atemwegserkrankungen mit Hustenreiz und zur Behandlung von leichten Entzündungen der Magenschleimhaut eingesetzt. Mehr dazu lesen Sie im folgenden Beitrag.
Erfahren Sie auf dieser Seite mehr zu folgenden Themen:
► Allgemeines zum Eibisch
Allgemeines zum Eibisch
- Beschreibung: krautige Pflanze aus der Familie der Malvengewächse (Malvaceae)
- Synonyme: Arznei-Eibisch, wilde Malve, Althee, Schleimwurzel, Weißwurzel, Heimischwurzel
- Vorkommen: Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Steppenzonen Südrusslands und Zentralasiens, an sonnigen Standorten mit Lehm- oder Tonböden
- wichtige Inhaltsstoffe: Schleimstoffe (Polysaccharide), Flavonoide, Gerbstoffe und ätherisches Öl
- Anwendungsgebiete: akute Atemwegserkrankungen, Entzündungen im Mund- und Rachenraum, trockener Reizhusten, Heiserkeit, leichte Entzündung der Magenschleimhaut
- mögliche Anwendungen: Tee, pflanzliche Arzneimittel, äußerliche Anwendung als Badezusatz oder Umschlag, Gewürz und Blattgemüse in der Küche
Woher kommt die Pflanze und wo ist sie in der Natur verbreitet?
Der Echte Eibisch (Althaea officinalis) gehört zur Familie der Malvengewächse. Die Pflanze stammt aus Südosteuropa und Westasien. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet reicht von den Steppenzonen Südrusslands und Kasachstans bis zum Altai-Gebirge, in Südeuropa vom Balkan über Italien bis zur Iberischen Halbinsel. In Mitteleuropa ist der Eibisch oft in Gärten anzutreffen. Die Malvenpflanze gedeiht bevorzugt auf den salzhaltigen Böden küstennaher Gebiete, kommt aber auch mit anderen Bodenqualitäten gut zurecht. Die Blütezeit erstreckt sich von Juli bis September.
Wie erkennt man die Pflanze?
Die mehrjährige Staude wird bis zu 2 Meter hoch und zeichnet sich durch samtig weich behaarte Blätter sowie mittelgroße weiße bis rosafarbene Blüten aus. Die graugrün gefärbten und glänzend seidigen Blätter haben eine drei- bis fünflappige Form und handförmige Blattadern. Die etwa 5 Zentimeter breiten, herzförmigen Malvenblüten werden zur Mitte hin dunkler. Der röhrige aufrechte Stängel ist wie die Blätter filzig behaart, der Wurzelstock fingerdick und ästig.
Woher kommt der Name?
Der Echte Eibisch (Althaea officinalis) wird auch Arznei-Eibisch genannt. Der botanische Name „Althaea“ leitet sich aus dem Altgriechischen ab und bezieht sich auf die heilsame Wirkung. Der zweite Teil des biologischen Artnamens („officinalis“) weist auf die traditionsreiche Wertschätzung als Heilpflanze hin, die wegen ihrer Inhaltsstoffe schon seit langer Zeit in der Apotheke angeboten wird: Als „Offizin“ wird heute noch der Verkaufsraum einer Apotheke bezeichnet.
Schleimgehalt, Aussehen und Wirkung brachten dem Eibisch einige vielsagende volkstümliche Bezeichnungen ein, wie Schleimwurzel, Samtpappel, Heilwurzel oder Hilfwurz.
Neben dem Echten Eibisch gibt es auch den Rauen Eibisch (Althaea hirsuta), die Stockrose (Althaea rosea) sowie den Roseneibisch (Hibiscus spec.).
Eibisch als Heilpflanze
Bei welchen Leiden und Krankheiten kommt Eibisch zur Anwendung?
In der Antike verwendeten die griechischen Ärzte Hippokrates und Dioskurides die Heilkraft des Eibischs zur Behandlung von Zahnschmerzen, Harnwegserkrankungen, Reizhusten und Krankheiten des Magen-Darm-Trakts sowie von Brandwunden, Stichen, feuchten Ekzemen und Abszessen.
Zu den heutigen medizinischen Anwendungen der alten Heilpflanze zählen:
- akute Atemwegserkrankungen
- Entzündungen im Mund- und Rachenraum
- trockener Reizhusten
- Heiserkeit
- leichte Entzündung im Magen-Darm-Bereich
Wie hilft der Eibisch gegen Erkältung?
Da Eibisch die Erkältungsabwehr unterstützt, eignet er sich in pflanzlichen Arzneimitteln für die Anwendung bei entzündlichen Atemwegserkrankungen gerade in der Anfangsphase besonders gut. Zudem verfügt die Pflanzendroge über einen hohen Schleimstoffgehalt. Entzündete oder gereizte Schleimhäute können dank der oberflächenabdichtenden Wirkung der Schleimstoffe schneller abheilen. Reizhusten, Hustenreiz und Heiserkeit, typische Erkältungssymptome bei gereiztem Rachen, lassen sich mit den Wirkstoffen des Eibischs lindern. Hinzu kommen schmerzdämpfende Eigenschaften der Heilpflanze.
Aufgrund seiner positiven Effekte bei der Abwehr von Erkältungen ist Eibisch auch in Imupret® N enthalten.
Beginnende Erkältung?
Imupret® N
Die einzigartige 7-Pflanzenkombination kann:
- Erkältungsabwehr stärken
- Erkältungserreger bekämpfen
- Erkältungsverlauf mildern
Wenn Erkältung entsteht: Imupret!
Welche medizinischen Wirkungen hat die Heilpflanze sonst noch?
Die enthaltenen Schleimstoffe können sich wie ein schützender Film auf gereizte oder entzündete Schleimhäute legen. Außer in den Atemwegen entfalten sie unter anderem im Magenbereich ihre schützende Wirkung, puffern Säure ab und sorgen für Linderung bei einer Magenschleimhautreizung bzw. -entzündung.
Anwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten
Welche Pflanzenteile werden verwendet?
Prinzipiell kommen Wurzel, Blätter und Blüten des Echten Eibischs für die heilkundliche Anwendung infrage. Die verwendeten Pflanzenteile unterscheiden sich dabei deutlich im Gehalt der medizinisch wirksamen Inhaltsstoffe.
Verwendete Pflanzenteile: Blätter, Blüten, Wurzeln
So enthalten die Blätter und Blüten des Eibischs neben sekundären Pflanzenstoffen wie Flavonoiden, ätherischen Ölen und Gerbstoffen nur wenig Schleimstoffe. Die Eibischwurzel wartet dagegen mit einem hohen Gehalt an polysacchariden Schleim von bis zu 35 % auf. Auch das pflanzliche Geliermittel Pektin sowie Stärke und Zucker kommen in der Wurzel reichlich vor. Für die Herstellung pflanzlicher Arzneimittel wird wegen des hohen Schleimstoffgehalts überwiegend die Eibischwurzel verwendet.
Die verschiedenen Pflanzenteile stehen in getrockneter Form sowie in verschiedenen Zubereitungen für die innere oder äußere Anwendung zur Verfügung: etwa in geschnittener Form (Wurzel oder Blätter) für die Teezubereitung, pulverisiert in Tabletten, als Trockenextrakt in löslichen Instant-Tees, als wässriger Auszug in Saft und Sirup sowie in Fertigarzneimitteln.
Worauf ist bei der Anwendung zu achten?
Nebenwirkungen, Gegenanzeigen oder Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind für den Eibisch nicht bekannt.
Bei Husten hat der dickflüssige Eibisch-Hustensaft oder -Sirup gegenüber dem Tee den Vorteil, länger an Ort und Stelle im Mund- und Rachenraum zu haften.
Menschen mit Diabetes mellitus sollten den hohen Zuckergehalt der Eibischwurzeln berücksichtigen.
Wie wird Eibisch-Tee zubereitet?
Eibisch-Tee ist vielfältig einsetzbar: Außer zum Trinken bei Husten und Erkältung eignet er sich auch zum Spülen und Gurgeln bei Entzündungen im Mundraum sowie äußerlich für Waschungen, Bäder oder Umschläge. Auf diese Weise helfen seine Wirkstoffe etwa gegen leichte Brandwunden, rissige Haut und Ekzeme.
Üblicherweise wird für die Zubereitung von Eibischtee das Verfahren als Kaltauszug empfohlen. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass Schleimdrogen auch mit heißem Wasser als Aufguss zubereitet werden können, ohne Schaden zu erleiden. Allerdings sind die Extraktausbeute und die Viskosität bei Kaltextraktion höher.
Dafür wird 1 Teelöffel geschnittene Eibischwurzel bzw. 1 Esslöffel geschnittene Eibischblätter (jeweils ca. 2 g) mit 150 ml kaltem Wasser übergossen und unter gelegentlichem Umrühren für 1 bis 2 Stunden stehen gelassen. Anschließend wird der Ansatz kurz zum Sieden erhitzt, dann wieder abgekühlt und durch ein Teesieb abgeseiht.

Was hat der Eibisch mit Marshmallows zu tun?
Die englischsprachige Bezeichnung für den Eibisch lautet „marsh mallow“, zu Deutsch „Sumpf-Malve“. Früher wurden aus den zuckerreichen Wurzeln der Pflanze die ersten Marshmallows hergestellt. Die beliebte weiche und klebrige Süßigkeit ist in Deutschland auch als „Mäusespeck“ bekannt. Heute erfolgt die industrielle Produktion mit Ersatzstoffen.
Wie schmeckt Eibisch?
Die Blätter der Eibisch-Pflanze sind geruchlos, die Wurzeln können einen mehligen Geruch haben. Geschmacklich ist Eibisch auch nicht jedermanns Sache. Aus den Blättern und Blüten der Pflanze kann ein Salat zubereitet werden. Sie sind schleimig und leicht süßlich im Geschmack.
Die Wurzeln können gekocht werden, sie sind sehr nahrhaft, allerdings eher fade im Geschmack. Früher wurde gekochte Eibischwurzel vor allem in Notzeiten gegessen.
Kann man auf Eibisch allergisch reagieren?
Für Eibisch sind zwar keine Nebenwirkungen und Gegenanzeigen bekannt, Betroffene können aber allergisch auf die Pflanze reagieren, wenn auch sehr selten.
Bei einer bekannten Allergie gegen Eibisch sollten pflanzliche Arzneimittel vermieden werden, da es durch die Einnahme sonst zu Nebenwirkungen und Komplikationen kommen kann.
Zusammen mit diesen Heilpflanzen trägt der Eibisch zur Wirkung des Phytotherapeutikums in Imupret® N bei Erkältungen bei:
Bildnachweise
Adobe Stock: LianeM | Adobe Stock: NewFabrika | Adobe Stock: chekman