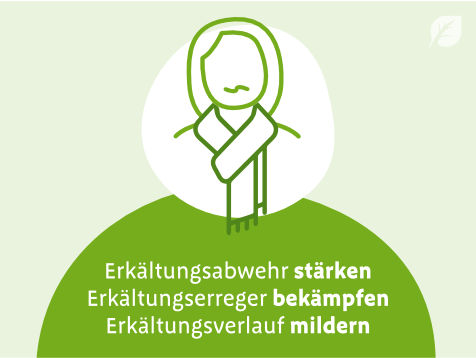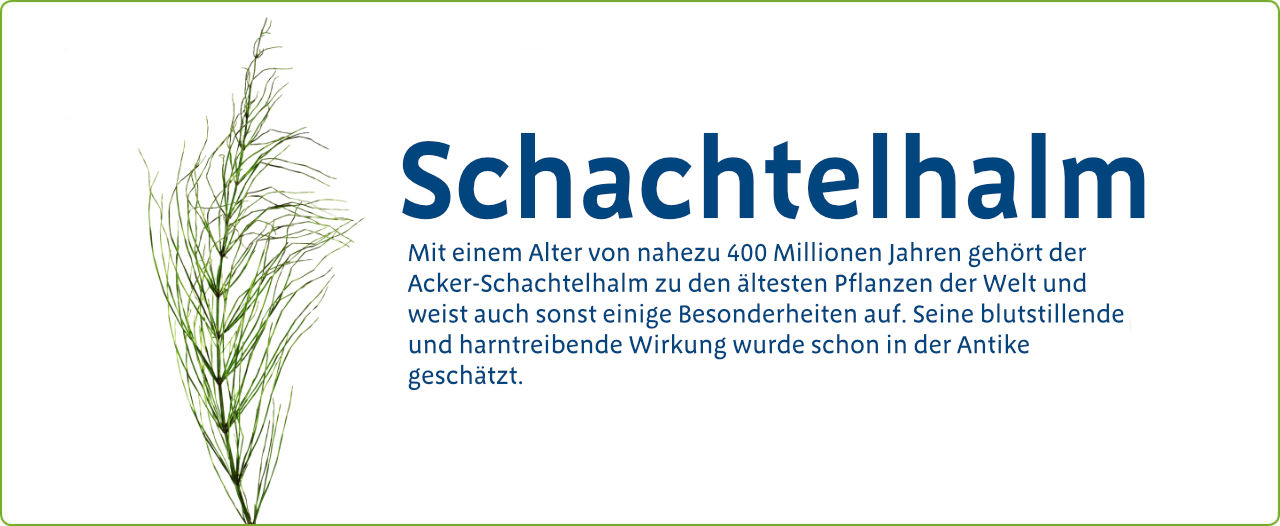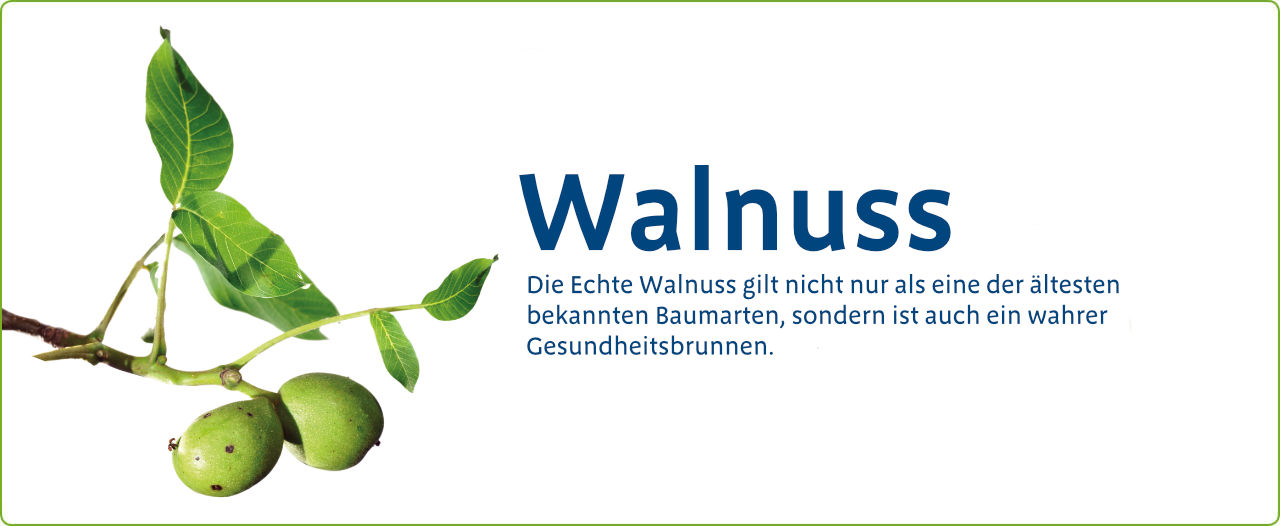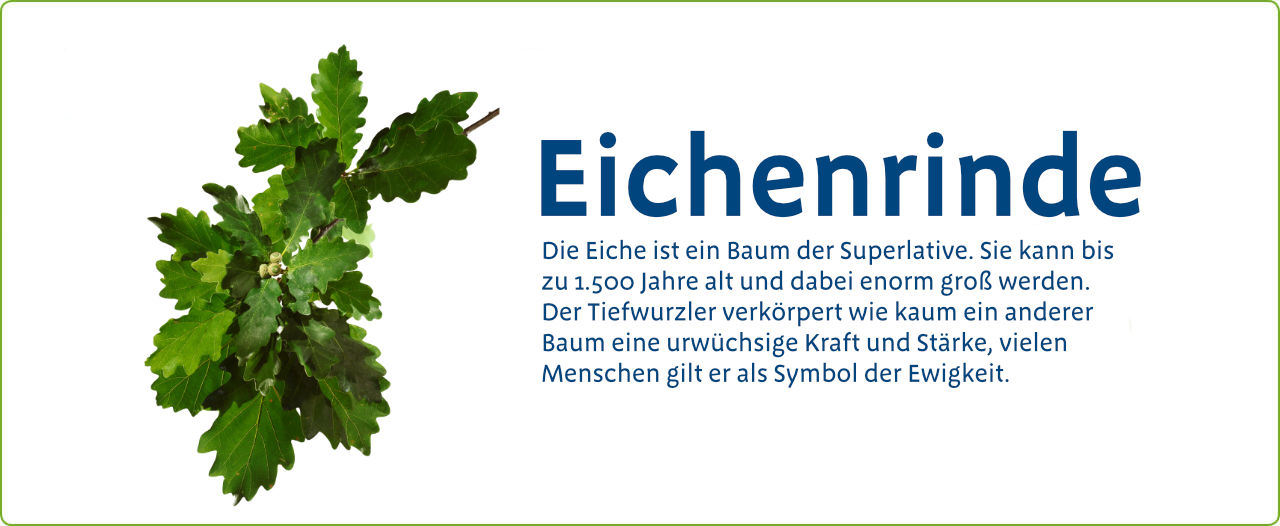Schafgarbe (Achillea millefolium)
Lesedauer: 4 Minuten
Die natürliche Heilkraft der Schafgarbe
Die Gewöhnliche oder Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) ist in unseren heimischen Gefilden zwar weit verbreitet, als Heilpflanze fristet sie aber, etwa im Vergleich zur Kamille eher ein Schattendasein – völlig zu Unrecht! Denn schon der botanische Name der Pflanzen mit den vielen weißen Blüten weist auf ihre besonderen Heilkräfte hin: Kein Geringerer als der berühmte Achilles soll der Sage nach im Krieg gegen Troja die Wunden seiner Soldaten mit Schafgarbenkraut behandelt haben. Mehr über die Wirkungen, Anwendungsgebiete und Besonderheiten der Schafgarbe lesen Sie im folgenden Beitrag.
Erfahren Sie auf dieser Seite mehr zu folgenden Themen:
► Allgemeines zur Schafgarbe
Allgemeines zur Schafgarbe:
Steckbrief Schafgarbe (Achillea millefolium)
- Beschreibung: krautige Pflanze aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
- Synonyme: Augenbraue der Venus, Achilleskraut, Bauchwehkraut, Beilhiebkraut, Blutstillkraut, Frauendank, Gotteshand, Lämmerzunge, Tausendaugbraun, Zangeblum
- Vorkommen: Europa, Nordamerika und Nord- und Westasien
- wichtige Inhaltsstoffe: Gerbstoffe, Flavonoide, Polyphenolsäuren, Bitterstoffe, ätherische Öle, Proazulene
- Anwendungsgebiete: Erkältungen, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, Anregung der Gallentätigkeit, Blasen- und Nierenerkrankungen, Menstruationsbeschwerde
- Mögliche Anwendungen: Tee, Tinktur, pflanzliche Arzneimittel, äußerliche Anwendung als Badezusatz oder Wundauflage
Wo wächst die Pflanze?
Die Schafgarbe gehört zur Pflanzenfamilie der Korbblütler. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Europa, Nordamerika und die gemäßigteren Zonen Nord- und Westasiens, wozu sich noch Nordafrika gesellt. Als anspruchslose, widerstandsfähige und anpassungsfähige Wiesenpflanze bevorzugt die Schafgarbe sonnige und trockene Standorte. Dabei kommt sie auch mit Dürre, Hitze, Kälte und selbst mit Höhenlagen über 3.000 Meter noch zurecht.
In der langen Blütezeit von Frühsommer bis Spätherbst sieht man die kleinen weißen oder rosa Blumen an Weg- und Ackerrändern sowie auf Wiesen, Halbtrockenrasen und Schafweiden.
Woran erkennt man die gemeine oder gewöhnliche Schafgarbe?
Ihr einzigartiges Aussehen sowie die vielfältigen Heilkräfte machen die Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) zu einer besonderen Pflanzenart. Der Korbblütler wird bis zu 1 m hoch und bildet einen kriechenden, mehrjährigen Wurzelstock. Auf dem einjährigen, meist verzweigten und blattreichen Stängel bilden sich doldenrispig angeordnete weiße, manchmal rosafarbene Blüten. Blätter und Stängel sind weich behaart, die Frucht ist klein und unauffällig.
Woher kommt der Name der Pflanze?
Ihren botanischen Namen Achillea verdankt die Schafgarbe Achilles, dem Helden der griechischen Mythologie. Der Artname „millefolium“ bedeutet übersetzt "Tausendblättrige" und spielt auf die feinen, filigran gegliederten Blätter an. Das gilt auch für die poetische Bezeichnung „Augenbraue der Venus“, die auch einen Bezug zur geschätzten Wirkung als „Frauenkraut“ herstellt.
Etwas schlichter leitet sich der deutsche Name der krautigen Pflanze von ihrem Vorkommen auf Schafweiden und der Vorliebe der Schafe für die zarten Blättchen ab. Die Bezeichnung „garbe“ wiederum lässt sich auf den althochdeutschen Begriff „garwan“ bzw. „garwe“ rückführen, der „gesund machen“ oder „heilen“ bedeutet.
Wie bei vielen traditionellen Heilpflanzen hat der Volksmund auch für die Schafgarbe eine Reihe von Synonymen parat, die vor allem mit ihrer vielfältigen phytotherapeutischen Wirkung und Anwendung zu tun haben. Eine kleine Auswahl von weiteren Namen: Achilleskraut, Bauchwehkraut, Beilhiebkraut, Blutstillkraut, Frauendank, Gotteshand, Lämmerzunge, Tausendaugbraun oder Zangeblume.
Ist Schafgarbe giftig?
Nein, die Gewöhnliche Schafgarbe ist nicht giftig. Es sind auch keine Nebenwirkungen bekannt, außer es besteht eine Allergie gegen die Schafgarbe, dann sollten Betroffene unbedingt auf die Einnahme verzichten.
Vorsicht Verwechslungsgefahr!
Die Heilpflanze Schafgarbe ist zwar selbst nicht giftig, es gibt aber giftige Doppelgänger von ihr. Daher sollte die Pflanze nur mit entsprechenden Vorkenntnissen selbst gesammelt werden. Verwechslungsgefahr besteht beispielsweise beim Gefleckten Schierling. Die weißen Blüten können denen der Schafgarbe sehr ähnlich sein. Das Gleiche gilt für das Wiesenschaumkraut und den Riesenbärenklau. So können Sie die Pflanzen unterscheiden:
- Gefleckter Schierling: Der Schierling wächst mit etwa 2 m deutlich höher als die Gemeine Schafgarbe mit nur etwa 80 cm. Verwechslungsgefahr besteht daher vor allem bei jüngeren Pflanzen, die noch nicht ihre volle Höhe erreicht haben. Der Gefleckte Schierling besitzt rötliche Flecken im Bereich der Stängel, diese sind das einfachste Unterscheidungsmerkmal. Zusätzlich verbreitet der Schierling einen unangenehmen Geruch, dies erfordert aber schon etwas mehr Pflanzen-Erfahrung.
- Wiesenschaumkraut: Die Verwechslung mit Wiesenschaumkraut ist harmlos, da Wiesenschaumkraut ebenfalls essbar ist, es besteht also keine Vergiftungsgefahr. Unterschieden werden können beide Kräuter durch einen Blick auf die Blätter. Bei der Schafgarbe wachsen die Blätter abwechselnd auf jeder Seite des Stängels und sind gefiedert und länglich. Die Blätter des Wiesenschaumkrauts sitzen an einem langen Blattstängel und sind eher rundlich.
- Riesenbärenklau: Beim Riesenbärenklau ist besonders große Vorsicht geboten, da bereits der Hautkontakt mit der Pflanze gefährlich ist. Die Berührung der Pflanze kann zu schmerzhaften verbrennungsähnlichen Wunden an der Hautstelle führen, die mehrere Wochen anhalten können. Auch der Riesenbärenklau ist viel größer als die Schafgarbe. Der Stängel ist deutlich dicker und hat rote Flecken.
Das selbstständige Sammeln von Schafgarbe ohne ausreichende Vorkenntnisse kann also durchaus gefährlich werden, vor allem für Kinder. Daher empfiehlt es sich, vor dem Verzehr im Zweifel immer einen Experten zu Rate zu ziehen.
Schafgarbe als Heilpflanze
Welche Inhaltsstoffe hat die Schafgarbe und wie wirken sie?
Die Schafgarbe verfügt über ein umfangreiches Spektrum an wertvollen Inhaltsstoffen mit positiven Wirkungen gegen eine Vielzahl von Beschwerden:
- Gerbstoffe: bekämpfen Erkältungserreger, zusammenziehende Wirkung und entzündungshemmende Wirkung
- Flavonoide: antibakterielle, entzündungshemmende, krampflösende Wirkung
- ätherische Öle: keim- und entzündungshemmende, krampflösende, beruhigende und blutstillende Wirkung
- Bitterstoffe: appetitanregend, gallefördernd und verdauungsfördernd
Ätherische Öle haben krampflösende und blutstillende Eigenschaften
Im ätherischen Öl der Schafgarbe wurden über 100 verschiedene Bestandteile entdeckt. Von Bedeutung sind zudem Proazulene (z. B. Guajanolide), aus denen bei der Weiterverarbeitung therapeutisch relevante Stoffe entstehen.
Die wertvollen Inhaltsstoffe machen die Schafgarbe zu einem beliebten Mittel bei Erkältungen, Magen-Darm-Beschwerden, Menstruationskrämpfen und Beschwerden bei der Wundheilung.
Wie hilft die Schafgarbe gegen Erkältung?
Das breite Wirkspektrum des Krauts lässt sich auch bei akuten Atemwegserkrankungen und besonders bei einer beginnender Erkältung therapeutisch nutzen. Günstig sind dabei vor allem solche Wirkungen, die sich gegen die Entzündung und Keimvermehrung in den Schleimhäuten richten und dort zur Beruhigung beitragen. Das macht die Pflanzendroge zu einer sinnvollen Komponente in pflanzlichen Erkältungspräparaten, wie Imupret® N.
Beginnende Erkältung?
Imupret® N
Die einzigartige 7-Pflanzenkombination kann:
- Erkältungsabwehr stärken
- Erkältungserreger bekämpfen
- Erkältungsverlauf mildern
Wenn Erkältung entsteht: Imupret!
Bei welchen Leiden und Krankheiten kommt die Schafgarbe sonst noch zur Anwendung?
Äußerlich kann das „Soldatenkraut“ auf der Haut sowohl bei blutenden und entzündeten Wunden sowie in Form von Leberwickeln zur Linderung des Völlegefühls bei chronischen Leberkrankheiten angewendet werden. Außerdem wirken Sitzbäder mit warmem Wasser wohltuend bei schmerzhaften Unterleibskrämpfen. Neben der äußerlichen Anwendung auf der Haut, wird die Schafgarbe heute vorwiegend innerlich angewendet und kommt, außer bei Erkältungen, bei Appetitlosigkeit und Verdauungsstörungen, zur Anregung der Gallentätigkeit, bei Blasen- und Nierenerkrankungen sowie bei Menstruationsbeschwerden zum Einsatz.
Schafgarben-Tee zur innerlichen Anwendung
Zur äußerlichen Anwendung eignen sich Schafgarbensud oder -tinktur etwa für Sitz- und Vollbäder sowie für Wundauflagen oder Wickel, z.B. aufgebracht auf Mullbinden. Für die innerliche Anwendung lässt sich die Schafgarbe als Tee, Öl und in Fertigarzneimitteln, z. B. in Form von Dragees oder Tropfen, nutzen.
Anwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten
Welche Pflanzenteile werden verwendet?
Für die Anwendung als Arzneidroge und Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln wird das blühende Kraut der Schafgarbe (Achillea millefolium) verarbeitet. Die getrockneten, blühenden Triebspitzen enthalten 0,2 bis über 1 % ätherisches Öl. Dieses hat maßgeblichen Anteil an der medizinischen Wirkung. Der Ölgehalt nimmt in den oberirdischen Pflanzenteilen von den Blüten über die Blätter bis zum Stängel ab. Die Ernte erfolgt zwischen Juni und September.
Zu beachten ist, dass es sich bei der Schafgarbe um eine Sammelart handelt, die aus vielen Klein- und Unterarten besteht. Das Spektrum an für die Wirkung relevanten Inhaltsstoffen kann dabei ziemlich variieren. Wer sichergehen möchte, ein wirkstoffreiches und damit therapeutisch wertvolles Kraut zu bekommen, sollte Schafgarbe nur in der Apotheke kaufen.
Worauf ist bei der Anwendung zu achten?
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder negative Nachwirkungen der Schafgarbe sind nicht bekannt. Vereinzelt gibt es Fälle einer Überempfindlichkeit oder Allergie, insgesamt sind allergische Reaktionen jedoch sehr selten. Zur Anwendung in der Schwangerschaft bestehen keine gesicherten Erkenntnisse.
Wie wird Schafgarben-Tee zubereitet?
Schafgarben-Tee ist fertig in der Apotheke, in Drogerien und Supermärkten, im Teefachhandel oder im Internet zu beziehen – oder kann selbst zubereitet werden: Dafür 1–2 Teelöffel Schafgarbenkraut mit 150 ml kochendem Wasser übergießen, 10 bis 15 Minuten ziehen lassen und anschließend den Teeaufguss durch ein Sieb abseihen.
Einfach 1–2 Teelöffel mit heißem Wasser übergießen
Als Tagesdosis gelten 4,5 g Schafgarbenkraut, aufgeteilt auf dreimal 1,5 g Droge (1 Teelöffel), was drei Tassen Tee entspricht. Spülungen mit Schafgarbentee haben sich bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum bewährt. Dabei kann die Schafgarbe auch mit Kamille kombiniert werden. Bei Appetitlosigkeit empfiehlt es sich, den Tee eine halbe Stunde vor der Mahlzeit zu trinken, bei Beschwerden im Magen-Darm-Trakt wie Verdauungsproblemen nach den Mahlzeiten, ansonsten dazwischen.
Für Sitzbäder werden übrigens 100 g Schafgarbenkraut auf 20 Liter Wasser empfohlen. Bei empfindlicher Haut sollten Sie darauf achten, nicht zu lange zu baden.
Schafgarbe (Achillea millefolium) – wichtige Fragen und Antworten auf einen Blick
Kann man Schafgarbe verwechseln?
Ja, Verwechslungsgefahr besteht vor allem mit dem Gefleckten Schierling, dem Riesenbärenklau und dem Wiesenschaumkraut. Das Wiesenschaumkraut ist dabei der harmloseste Irrtum, da das Kraut selbst ebenfalls zu den essbaren Pflanzen gehört und demnach nicht giftig ist. Anders sieht es aber beim Schierling und dem Riesenbärenklau aus. Beide Pflanzen können schwere Vergiftungserscheinungen verursachen, beim Riesenbärenklau sogar bereits durch Hautkontakt.
Aus diesem Grund sollte Schafgarbe niemals ohne entsprechende Kenntnisse selbst gesammelt werden. Ziehen Sie im Zweifel immer einen Experten zu Rate.
Was sammelt man von der Schafgarbe?
Wer sich gut auskennt oder selbst Schafgarbe anpflanzt, ist mit der Frage konfrontiert, was genau eigentlich alles von der Schafgarbe geerntet werden kann. Tatsächlich können die gesamten überirdischen Teile der Pflanze verwendet werden, von den Blüten bis zum Stängel. Erntezeit ist hier in Deutschland je nach Sorte zwischen Juni und September. Die Pflanze sollte etwa 15 bis 20 cm über dem Boden abgeschnitten werden, so kann die Pflanze erneut austreiben.
Die Blätter können frisch verwendet werden, beispielsweise im Salat, oder Sie trocknen die gesamte Pflanze. Binden Sie dafür die gesammelten Stängel mitsamt Blättern und Blüten zu einem Bündel zusammen und hängen dieses mit den Blüten nach unten an einem luftigen, abgedunkelten Ort auf.
Zusammen mit diesen Heilpflanzen trägt der Schafgarbe zur Wirkung des Phytotherapeutikums in Imupret® N bei Erkältungen bei:
Bildnachweise
Adobe Stock: visuals-and-concepts | Adobe Stock: chekman