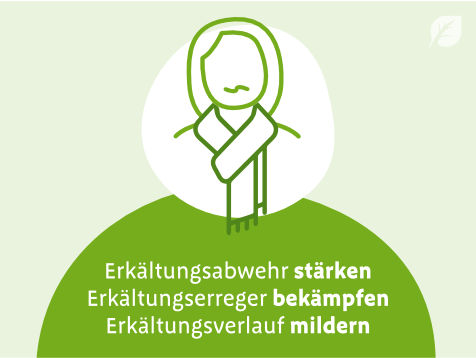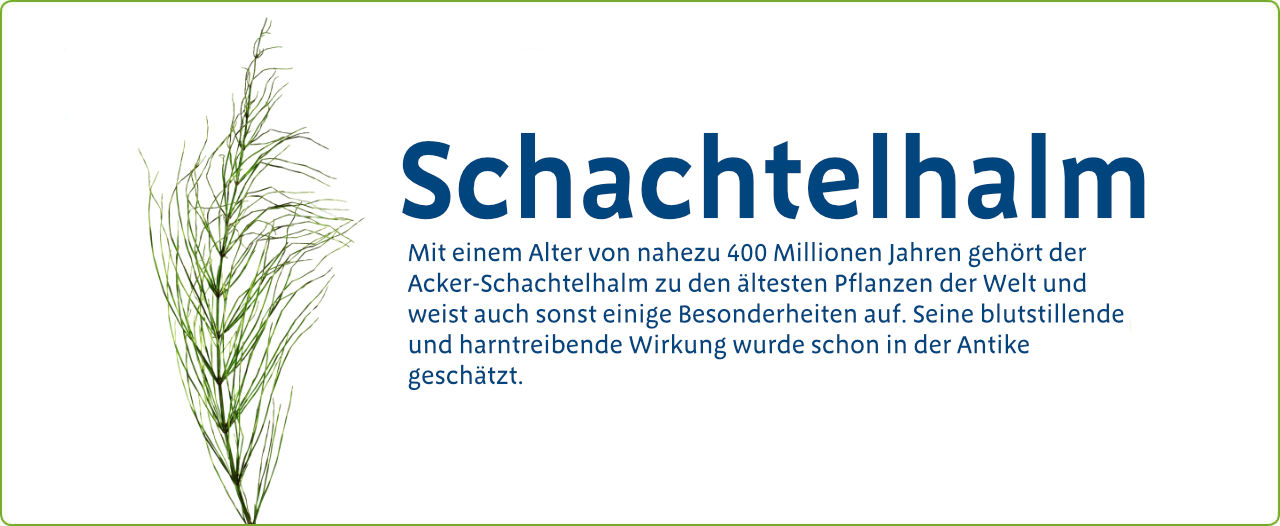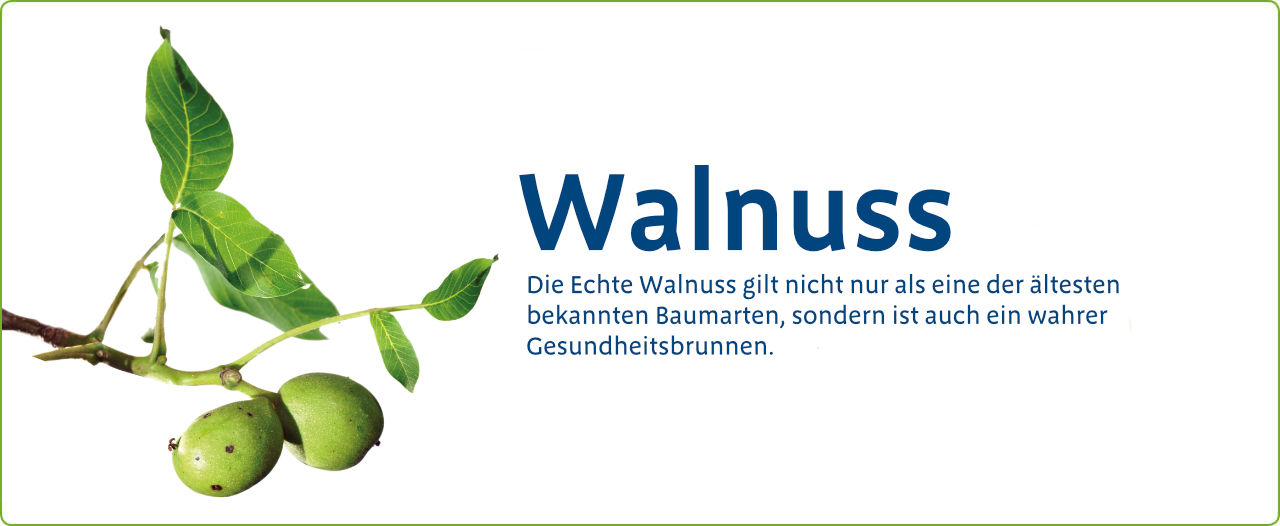Stieleiche (Quercus robur)
Die natürliche Heilkraft der Eiche
Die Eiche ist ein Baum der Superlative. Sie kann bis zu 1.500 Jahre alt und dabei enorm groß werden. Der Tiefwurzler verkörpert wie kaum ein anderer Baum eine urwüchsige Kraft und Stärke, vielen Menschen gilt er als Symbol der Ewigkeit. Die Eiche ist zudem nicht nur wirtschaftlich als Holz- und Rohstofflieferant sowie kulturell von besonderem Interesse – sondern auch als Heilpflanze. Von den etwa 600 Eichenarten, die weltweit bekannt sind, kommt die Stieleiche (Quercus robur) in Deutschland am häufigsten vor.
Erfahren Sie auf dieser Seite mehr zu folgenden Themen:
► Allgemeines zur Eiche
Allgemeines zur Eiche
Steckbrief Stieleiche (Quercus robur)
- Beschreibung: 20–40 m hoher Laubbaum aus der Gattung der Eichen (Quercus) in der Familie der Buchengewächse (Fagaceae)
- Synonyme: Stiel-Eiche, Sommereiche, Deutsche Eiche, Eik, Masteiche
- Vorkommen: Mitteleuropa, auf nährstoffreichen Lehm- und Tonböden
- wichtige Inhaltsstoffe: Gerbstoffe (Tannine), Flavonoide, Bitterstoffe
- Anwendungsgebiete: akute Durchfallerkrankungen, Hauterkrankungen, Erkältungen, Verletzungen und Wunden
- Mögliche Anwendungen: Tee, Tropfen, Tabletten, pflanzliche Arzneimittel oder äußerlich als Tinktur oder Sitzbad
Woher kommt die Eiche und wo ist sie heute verbreitet?
Tausendjährige Eichen prägten in längst vergangenen Zeiten das Bild der europäischen Urwälder. Das eigentliche Hauptverbreitungsgebiet der artenreichen Gattung Quercus ist Nordamerika. Die Stieleiche ist in fast ganz Europa heimisch und in den Bayerischen Alpen bis in Höhenlagen von 1.000 Metern ansässig.
Eichen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Laubwälder. Sie mögen es warm und bevorzugen niedrige, feuchte Lagen mit nährstoffreichen, tiefgründigen Lehm- und Tonböden. Auf kargem Boden wird die Eiche leicht von der in Deutschland zahlenmäßig überlegenen Buche vertrieben.
Woran erkennt man die Eiche?
Auch für Menschen, die nicht vom Fach sind, ist die Eiche leicht an ihren typisch gelappten Blättern und den charakteristischen Eicheln zu erkennen. Selbst im unbelaubten Zustand fällt es nicht schwer, die Art zu identifizieren: mächtiger Stamm mit sehr dicker Borke, knorrige, horizontal abstehende Äste und eine ausladende, unregelmäßig geformte Krone. Der sommergrüne Tiefwurzler kann 50 m hoch werden und als Solitärbaum einen Stammumfang von bis zu 8 m erreichen.
Die Blütezeit umfasst die Monate April und Mai, die Früchte reifen in Form der Eicheln von September bis Oktober. An den etwa 4 cm langen Stielen, die der Stieleiche ihren Namen geben, sitzen bis zu fünf Eicheln. Sie dienen vielen Tieren als Nahrungsquelle, wodurch auch ihre Verbreitung sichergestellt ist.
Die Stieleiche ist ein einhäusiger Baum und trägt somit sowohl männliche als auch weibliche Blüten – aber erst, wenn sie im Alter von 60 bis 80 Jahren zum ersten Mal blüht und keimfähige Eicheln bildet. Die Stieleiche (Quercus robur) wird auch „Sommereiche“ genannt, weil sie früher blüht als die Trauben-Eiche (Quercus petraea, „Wintereiche“).
Eiche als Heilpflanze
Welche Inhaltsstoffe finden sich in der Eichenrinde und welche Wirkung haben sie?
Hauptwirkstoff der Eiche sind aus naturheilkundlicher Sicht die Gerbstoffe (Tannine) in der Baumrinde (Quercus cortex für Eichenrinde). Sie reagieren mit körpereigenen Eiweißmolekülen der Haut und Schleimhäute und überführen sie in funktionslose, unlösliche Verbindungen. Die Zellen der obersten Hautschicht verlieren dabei Wasser und es entsteht ein Schutzfilm.
Medizinisch resultieren daraus einige Vorteile, etwa ein erschwertes Eindringen von körperfremden Stoffen wie Giftstoffen und Krankheitserregern, beispielsweise an der Mundschleimhaut.
Das Wirkungsspektrum im Überblick:
keimhemmend, virustatisch
entzündungshemmend
regenerierend
gewebeverdichtend, abdichtender Effekt an Haut und Schleimhäuten
zusammenziehend und austrocknend (förderlich für die Wundheilung)
verminderte Durchlässigkeit der feinsten Verzweigungen von Blut- und Lymphgefäßen
blutstillend
schweißhemmend (bei übermäßiger Schweißproduktion)
juckreizlindernd (durch Abschwächung der Nervenreize in der Haut)
Der Gerbstoff-Anteil in der Eichenrinde ist mit bis zu 20 % sehr hoch, wobei vor allem kondensierte Gerbstoffe vom Catechin-Typ vertreten sind, aber auch vom Ellagitannin-Typ und andere komplexe Tannine.
Als weitere Inhaltsstoffe sind noch Bitterstoffe und vor allem Flavonoide interessant, die ihrerseits auch eine entzündungshemmende Wirkung ausüben. Dazu zählt auch Quercetin, von dem ein antioxidativer und damit schützender Effekt gegen Zellschädigungen bekannt ist.
Bei welchen Leiden und Krankheiten werden eichenhaltige Präparate verwendet?
Die Rinde der Eiche wurde schon in der Antike wegen ihrer austrocknenden Wirkung bei der Wundbehandlung geschätzt. Auch bei unspezifischen Durchfallerkrankungen war die Eichenrinde ein beliebtes Mittel. In früheren Zeiten kamen außer der Rinde auch kleingeschnittene, geröstete Eicheln als Eichelkaffee zum Einsatz, um das Immunsystem schwächlicher Kinder zu stärken.
Als traditionelles pflanzliches Arzneimittel werden Präparate mit Eichenrinde heute offiziell für folgende Anwendungsgebiete empfohlen:
- zur lokalen Behandlung von entzündeten Schleimhäuten im Mund- und Rachenraum
- äußerlich bei entzündlichen Hauterkrankungen und nässenden Ekzemen
- Atemwegsinfekte (Erkältungen)
Wie hilft die Eichenrinde gegen Erkältung?
Rinden-Extrakte können bei Atemwegsinfekten nützlich sein. Die enthaltenen Gerbstoffe bekämpfen Erkältungserreger direkt, wirken schleimhautschützend und entzündungshemmend. Mit diesen Eigenschaften vervollständigen sie das vielseitige Wirkspektrum von Imupret® N im Einsatz gegen Erkältungen.
Beginnende Erkältung?
Imupret® N
Die einzigartige 7-Pflanzenkombination kann:
- Erkältungsabwehr stärken
- Erkältungserreger bekämpfen
- Erkältungsverlauf mildern
Wenn Erkältung entsteht: Imupret!
Was ist bei der Anwendung zu beachten?
Risiken und Nebenwirkungen sind bei bestimmungsgemäßen Dosierungen (innerlich: 3 g) nicht bekannt. Mit Wechselwirkungen ist bei äußerer Anwendung ebenfalls nicht zu rechnen. Wegen des hohen Gerbstoffgehalts reagieren empfindliche Menschen auf eingenommene Zubereitungen mit Eichenrinde eventuell mit Magenbeschwerden.
Beachten Sie bitte auch folgende wichtige Hinweise:
- Wenn Durchfälle lange andauern, sich wiederholen oder blutig werden, ist unbedingt ärztlicher Rat einzuholen.
- Auf Vollbäder sollte bei Fieber, bei Herzschwäche oder Bluthochdruck in jeweils höheren Schweregraden sowie bei großflächigen Hautschäden und Ekzemen verzichtet werden.
- Eichenrinde darf bei großflächigen Hautverletzungen nicht äußerlich angewendet werden.
Anwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten
Wie wird die Eichenrinde angewendet?
Wie bei anderen Arzneipflanzen stehen für die äußerliche Anwendung verschiedene Zubereitungen zur Verfügung, vor allem in Form von Tinkturen bzw. Essenzen, Salben, Cremes, Extrakten oder auch für die innerliche Anwendung als Tabletten und Tee. Die unterschiedlichen Darreichungsformen lassen sich je nach Bedarf für Umschläge, Fuß-, Sitz- und Vollbäder, zum Abtupfen und zum Gurgeln oder Spülen nutzen.
Fertigarzneimittel mit Kombinationen aus Eiche und anderen Heilpflanzen werden etwa gegen Erkältungen (z. B. Imupret® N Dragees und Tropfen) zur innerlichen Anwendung angeboten. Wenn Sie sich selbst um die Zubereitung kümmern wollen, können Sie die getrocknete Rinde in der Apotheke beziehen. Eine solche Empfehlung für Umschläge, Spülungen und Gurgellösungen lautet: 20 g Droge in 1 Liter Wasser 10 bis 15 Minuten lang kochen, dann die Rinde abseihen und den Sud nutzen.
Welche Teile der Eiche werden in der Pflanzenheilkunde genutzt?
Für die phytotherapeutische Wirkung sind vor allem die Gerbstoffe in der Eichenrinde verantwortlich. Während die Rinde in jungen Jahren glatt und glänzend erscheint, wird sie mit zunehmendem Alter dick, längsrissig und rau. Als Droge wird ausschließlich die im Frühjahr geerntete und getrocknete Eichenrinde von jungen Zweigen und Trieben verwendet. In den noch zarten, etwa 4 mm dicken Rindenstücken, die vor dem Austreiben der Blätter abgeschält werden, findet sich der höchste Gerbstoffgehalt.
Wie wird Eichenrinden-Tee zubereitet?
Der Eichenrinden-Tee gilt als wirksames Hausmittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenbereich sowie bei Durchfall. Aufgrund des hohen Gerbstoffgehaltes ist der Geschmack wie auch bei einigen anderen Mitteln allerdings nicht angenehm. –Außerdem fühlt sich die Mundschleimhaut nach dem Trinken ausgetrocknet und rau an. Das mag zunächst etwas befremdlich sein, ist aber ein therapeutischer Effekt, der durch den Schutzfilm zustande kommt, mit dem die Gerbstoffe bei örtlicher Anwendung entzündete Stellen abdichten.
Tee-Zubereitung: Einen halben Teelöffel (1 g) fein geschnittener oder grob pulverisierter Droge mit 1 Tasse (150 ml) kaltem Wasser übergießen, aufkochen und nach 5 bis 10 Minuten abseihen. Als Tagesdosis werden 3 g Droge empfohlen, also dreimal eine Tasse täglich. Ein Teeaufguss kann auch zur äußeren Anwendung als Gurgellösung oder Spülung sowie für Umschläge und (Teil-) Bäder genutzt werden.
Welche Wirkung hat ein Vollbad mit Eichenrinde?
Ein Vollbad mit Zusatz dieser Heilpflanze kann bei leichten entzündlichen Hauterkrankungen, Neurodermitis oder Entzündungen im Intimbereich Linderung verschaffen.
Zubereitung als Badezusatz:
- 100 g Eichenrinde in einen großen Kochtopf geben, mit 1 Liter kaltem Wasser übergießen und den Ansatz zum Kochen bringen.
- Nach 20 Minuten wird der Sud abgegossen und nach Abkühlung dem Badewasser zugesetzt.
- Für Sitz- oder Fußbäder kann man die Mengen auch halbieren, also 50 g Rinde mit 500 ml Wasser ansetzen.
- Die Badetemperatur sollte bei 32 °C bis 37 °C liegen, die Badedauer bei 20 Minuten.
Stieleiche (Quercus robur) – wichtige Fragen und Antworten auf einen Blick
Ist Eiche eine Heilpflanze?
Ja, Eichenrinde ist eine beliebte Heilpflanze und wird sowohl äußerlich als auch innerlich bei verschiedensten Beschwerden eingesetzt. Äußerlich als Tinktur oder Sitzbad können die Inhaltsstoffe der Eichenrinde zur Linderung von Haut- und Schleimhauterkrankungen sowie dem Abheilen von Wunden beitragen. Innerlich in Form von Tabletten, Tropfen oder auch als Tee hilft Eichenrinde bei Durchfall, Erkältungen und unterstützt das Immunsystem.
Wofür ist Eichenrindenextrakt gut?
Eichenrindenextrakt wird für die äußerliche Behandlung von Wunden sowie Haut- und Schleimhauterkrankungen eingesetzt. Das Extrakt kann dabei als Umschlag oder als Fuß- bzw. Sitzbad angewendet werden. Die in der Eichenrinde enthaltenen Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, keimhemmend und juckreizstillend. Diese Effekte macht man sich beispielsweise bei entzündlichen Hauterkrankungen und Ekzemen zunutze, um die Beschwerden zu lindern.
Was bewirkt Eichenrinde?
In Eichenrinde sind wertvolle Gerbstoffe, Flavonoide und Bitterstoffe enthalten. Diese haben unterschiedliche Effekte auf den Körper, abhängig davon, ob sie äußerlich oder innerlich angewendet werden.
Innere Anwendung:
- antiviral und antibakteriell
- entzündungshemmend
- stopfend
Äußere Anwendung:
- zusammenziehend (auf die Gefäße)
- entzündungshemmend
- blutstillend
- schweißhemmend
- juckreizstillend
- antimikrobiell
Zusammen mit diesen Heilpflanzen trägt der Eiche zur Wirkung des Phytotherapeutikums in Imupret® N bei Erkältungen bei:
Bildnachweise
Adobe Stock: maxximmm | Adobe Stock: allenpaul1000 | Adobe Stock: chekman